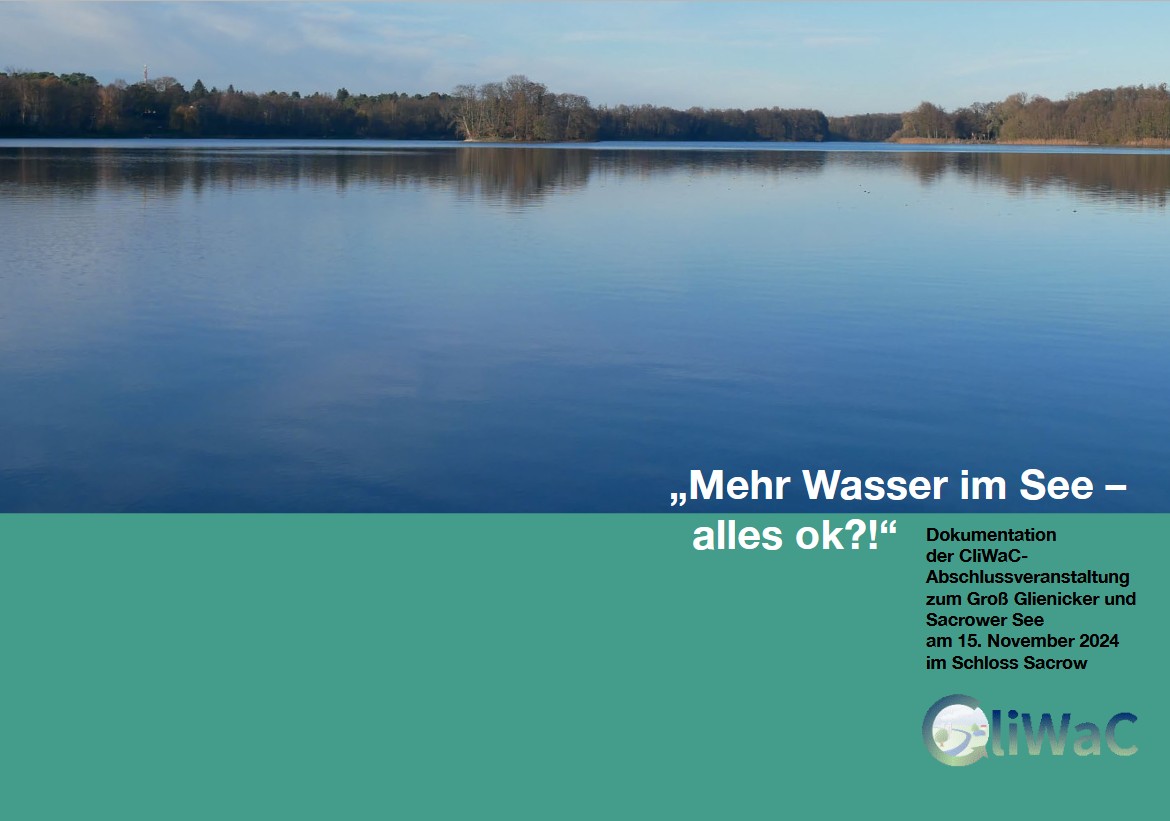Die transdisziplinäre Forschungsinitiative Climate and Water under Change – kurz CliWaC – ist ein Verbund aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der TU, FU, HU Berlin und der Charité sowie des ZALF (Leipnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung) und IÖW (Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung) haben die Veränderungen des Wasserhaushaltes in der Metropolregion Berlin in den Blick genommen. Rund 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren an dem Projekt beteiligt. Gefördert wurde dieses Millionen-Projekt durch BUA und die Einstein Stiftung Berlin. Ziel des Projektes war es die durch den Klimawandel verursachten Risiken zur Verfügbarkeit und Qualität von Wasser zu erforschen und aus den Erkenntnissen Handlungsempfehlungen an die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Politik und Verwaltung geben zu können.
Das Projekt ist hier nur sehr verkürzt und rudimentär wiedergegeben. Alle Details zu CliWaC können Sie unter www.cliwac.de nachlesen.
Das Gesamtprojekt umfasst 3 Fallstudien und wurde mit einen Studienzeitraum von 3 Jahren angesetzt.
Fallstudie 1: Hydrogeologische System des Groß Glienicker Sees und des Sacrower Sees
Fallstudie 2: Spree und Spreeeinzugsgebiet
Fallstudie 3: Extreme Regenfälle in einem städtischen Gebiet
Die Fallstudie 1 befasste sich mit der Problematik der sich verändernden Grundwasserressourcen der beiden Seen und ihrer Einzugsgebiete, die zu einem gemeinsamen hydrogeologischen System gehören, das sich über die Landesgrenze Berlin-Brandenburg erstreckt.
Die am Prozess beteiligten Initiativen konnten das Wissenschaftlerteam der CliWaC-Fallstudie 1 dafür begeistern, die gewonnen Erkenntnisse nicht nur – wie üblicherweise nach solchen Projekten – in entsprechenden Fachzeitschriften zu veröffentlichen, sondern die Erkenntnisse auch allgemein der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Deshalb hat nach Abschluss der 3-jährigen Forschungsarbeit der ArsSacrow e.V. als Veranstalter, das Forschungsteam der Fallstudie 1 im November 2024 wieder ins Schloss Sacrow eingeladen – hier fand auch zu Beginn des Projektes die Auftaktveranstaltung statt – , um den beteiligten Ortsbeiräten, Bürgerinitiativen und weiterer Initiativen der lokalen Zivilgesellschaft sowie Vertreter und Vertreterinnen aus der Potsdamer und Berliner Verwaltung und Politik, den Naturschutzverbänden und den Berliner Wasserbetrieben die bisher erzielten Ergebnisse in Kurzform zu präsentieren und auch mit ihnen zu diskutieren.
Um diese Veranstaltung und die Ergebnisse aus der Fallstudie 1 der interessierten Öffentlichkeit aber vor allem den Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen zur Verfügung stellen zu können haben wir als Mitherausgeberin eine Broschüre herausgegeben, die den Ablauf und die Inhalte der Veranstaltung dokumentiert.
Hier können Sie diese Dokumentation nachlesen.
Zusammengefasst: CliWaC hat in ihren Teilstudien zu den naturwissenschaftlichen Fachbereichen: Klima, Wasserqualität, Hydrologie und Hydrogeologiesowie in den Bereichen der Sozialwissenschaften zu Bevölkerung, Umweltrecht, Resilienz und Alltagsperspektiven transdisziplinär geforscht. Dazu wurden auch See-Modelle erstellt. Soweit möglich werden die Ergebnisse später in eine neu entwickelte Explorer-Plattform eingearbeitet und zur Verfügung gestellt werden.
Um diese komplexen Zusammenhänge angemessen erforschen zu können, wurden die sozial – und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Forschenden mit dem praktischen Fachwissen der Stakeholder im Rahmen eines innovativen methodischen Ansatzes vereint. Heißt, hier wurden die Initiativen vor Ort und die Zivilgesellschaft aktiv in den Forschungsprozess z.B. durch Workshops, Interviews etc. eingebunden. Dadurch ist auch ein reger Austausch zwischen Wissenschaft und Zivilbevölkerung entstanden, von dem beiden Seiten nachhaltig profitiert haben.
Die Kernaussage der Ergebnisse ist, dass die Hauptverantwortlichkeit des massiv gesunkenen Wasserstandes in den Klimaeinflüssen bzw. in der Klimavariabilität, also den Klimaveränderungen und der negativen Grundwasserneubildung (die hier schon seit Jahren defizitär ist) und der Nutzung des Grundwasserleiters liegt.
Als Handlungsempfehlungen aus der Studie wird als konkrete Maßnahme zur Stabilisierung der Seenwasserspiegels empfohlen, gereinigtes Havelwasser in Phasen ohne Wasserdefizit (also Winterhavel(hoch)wasser) direkt in den See zu leiten.
- Mit dem Auffüllen der Seenkörper werden gleichzeitig angeschlossene Feuchtgebiete wiederhergestellt und die Grundwasserstände schnellstmöglich und effizient stabilisiert
- Die Verfügbarkeit von Grundwasser zur Trinkwassergewinnung verbessert und langfristig gesichert
- Der Grundwasserkörper aber auch die Seen werden dadurch gestärkt und für die Zukunft resilienter
- Das Hauptziel dieser Managementmaßnahme ist die ganzheitliche Stabilisierung des Landschaftswasserhaushaltes
- Weiter soll auch Niederschlagswasser als auch mehrfach gereinigtes Klar- und Abwasser in der Landschaft gehalten werden
- Dafür braucht es Puffer – und Speicherkapazitäten, für die sich der Groß Glienicker als auch der Sacrower See durch ihre Grundwasserverbindung eignen
Nachweislich ist der Zustand und die Zukunft der Seen der umliegenden Bevölkerung wirklich eine Herzensangelegenheit! Die Seen haben viele Bedeutungen: Erholungsziel, Treffpunkt sozialer Beziehungen aber auch historisches Denkmal, sie sind Bindeglied zwischen Mensch und Natur und werden nun auch erstmals zum verbindenden Element – im länderübergreifenden Kampf um deren Erhalt.
Die im Anschluss der Veranstaltung erfolgte Diskussion ist ebenfalls in der Broschüre dokumentiert.
Hierbei wurde angemerkt, dass die Ergebnisse und Empfehlungen der CliWaC in die Aufgaben – und Fragestellungen zur Machbarkeitsstudie (MBS) aufgenommen bzw. die MBS entsprechend angepasst werden sollte. Zur Erinnerung: 2021/22 wurde von Potsdam und Spandau gemeinsam ein Dialogverfahren für eine MBS für den Groß Glienicker und den Sacrower See auf den Weg gebracht, welches 2023 beendet wurde. Der Fördergelder für die MBS wurde nun bewilligt, die Ausschreibung zur MBS erfolgt wohl noch 2025, vieleicht auch erst 2026.
Die Juristen merkten an, für die Zivilgesellschaft sei es aussichtsreicher und sinnvoller, politisch-gesellschaftlichen Druck auf Politik und Verwaltung und die entsprechende EntscheidungsträgerInnen auszuüben, als zu klagen, da hier (in Deutschland) das Umweltrecht eher defensiv ist. Es ist einfacher gegen Gefahren zu klagen als zur Verbesserung Maßnahmen juristisch einzuklagen.
Dazu ist noch ein kurzer Exkurs angehängt, indem die weitgehende Übereinstimmung der vonseiten des CliWaC-Teams präsentierten Ergebnisse mit dem aktuellen Erkenntnisstand des Brandenburger Umweltministeriums (MLEUV) und des Landesamtes für Umwelt (LfU) mit Grafiken anachaulich bebildert ist.
Unser Fazit entspricht den vorgenannten Handlungsempfehlungen aus dem CliWaC-Projekt, für das wir hier uns alle aktiv einsetzen!
Bürgerinitiative-Pro-Groß-Glienicker-See e.V. (BiPGGSee e.V.) | www.pro-gross-glienicker-see.info | 14089 Berlin – Kladow